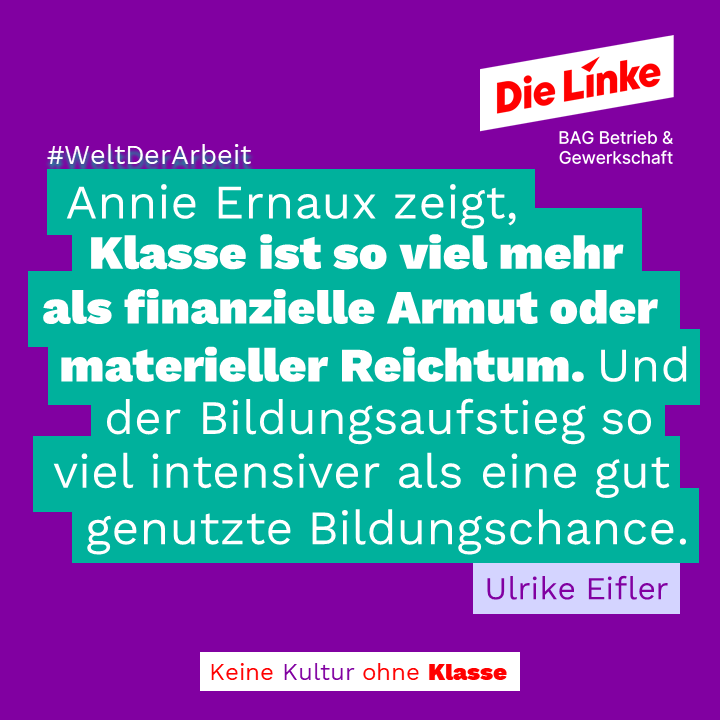Annie Ernaux: Die leeren Schränke

Von Ulrike Eifler
Nur ein Satz steht auf dem Erstlingsroman der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux: „Ich bin ja nicht mit dieser Wut zur Welt gekommen“. Ein Satz, der ebenso sensibel wie schnörkellos zusammenfasst, was sie im Inneren des Buches entwickelt. Mit analytischer Schärfe und großer Empathie fragt sie darin nach den habituellen Grenzen der Bildungsaufsteiger und den Gründen für das nicht immer einfache Verhältnis von Intellektuellen und Lohnabhängigen. Unsere Bundessprecherin Ulrike Eifler hat das Buch für die Februarausgabe der Zeitschrift Sozialismus besprochen.
Ein halbes Jahrhundert und den Nobelpreis für Literatur hatte es gebraucht, bis der Erstlingsroman der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux ins Deutsche übersetzt wurde. Unter der neuen Normalität der fortschreitenden Dauerkrise lassen sich offenbar auch in Deutschland die Folgen von Klassenspaltungen nicht länger unter den Teppich des sozialen Ausgleichs kehren. So zeigt ein Blick in die soziologischen Debatten der letzten Jahre ein wachsendes Bedürfnis, Klassenerfahrungen einzuordnen und zu diskutieren. In Frankreich, wo der Widerspruch zwischen den Klassen gesellschaftlich stärker verinnerlicht scheint, hat sich mit den Büchern von Ernaux ein literarisches Genre entwickelt, das den soziologischen Diskussionen auf der Ebene der Literatur Rechnung trägt. Durch autofiktionales Schreiben gelingt es ihr, eine maximale Distanz zu ihrem eigenen Leben herzustellen. Autobiografische Erfahrungen werden als Erfahrungshorizont der unteren Klassen verallgemeinert und in einen gesellschaftskritischen Kontext gestellt. Mit analytischer Schärfe und großer Empathie fragt Ernaux in ihren Büchern immer wieder nach den habituellen Grenzen der Bildungsaufsteiger und liefert wertvolle Denkanstöße zum nicht immer einfachen Verhältnis von Intellektuellen und Lohnabhängigen. Das nun vorliegende Buch – ihr Debüt – erobert seine deutsche Leserschaft mit 50 Jahren Verspätung, was seine Kraft und Empathie auf keiner der 180 Seiten beeinträchtigt.
Verfasst 1973 trägt das Buch den unverfänglich anmutenden Titel „Die leeren Schränke“. Der Titel kommt literarisch ansprechend daher, jeder Gesellschaftskritik unverdächtig. Doch der Satz, der auf dem Klappentext prangt, stellt unmissverständlich klar: auch in ihrem Debüt wird der soziografische Anspruch offenbar, den wir aus ihren späteren Büchern kennen. Es ist nur dieser eine Satz, der dort steht, ein einziger, messerscharfer Satz: „Ich bin ja nicht mit dieser Wut zur Welt gekommen“. Ein Satz, der ebenso sensibel wie schnörkellos zusammenfasst, was sie im Inneren des Buches entwickelt. Im Fließtext, bruchlos, ohne Zwischenüberschriften und nur mit wenigen Absätzen erzählt Ernaux die Geschichte der zwanzigjährigen Literaturstudentin Denise Lesur. Verkrochen in ihr Studentenzimmer wartet sie darauf, dass ihr Körper die Abtreibung vollzieht, die eine Engelmacherin eingeleitet hat. Und während sie unter Krämpfen Todesängste aussteht, fragt sie sich, was ihre Eltern wohl sagen würden, wenn sie sie so sähen. Sie spürt ihrer Kindheit und Jugend nach, fragt nach Gründen für Verhaltensmuster und Lebenswege und sucht schließlich nach Erklärungen für eine Gefühlswelt, in der sich Demütigungen und Arroganz, Genugtuung und Wut, Hass und Liebe, Scham und Trotz untrennbar ineinander verwoben haben.
Aufgewachsen in der provinziellen Rue Clopart, weit weg von der Innenstadt, ist Denise die einfache, raue Art der sogenannten „kleinen Leute“ gewohnt. Der Vater führt eine Kneipe, die Mutter einen Krämerladen. Kunden, die ihre Einkäufe anschreiben lassen müssen, gehören zu diesem Leben dazu. Ebenso wie Gäste, die sich betrinken, vulgär pöbeln, gieren, sich übergeben. Als Denise ins schulfähige Alter kommt und fortan die katholische Schule besucht, lernt sie eine andere, ihr bis dahin fremde Welt kennen. Nichts dort ist wie im Laden oder der Kneipe. Manchmal taucht Vertrautes auf, etwa wenn der Gärtner in seiner schmutzigen Jacke unter dem Fenster des Klassenzimmers vorbeiläuft. Doch meist bleibt die Schule ein fremder Ort, an dem sich Denise in allem von ihren Mitschülerinnen unterscheidet: in ihrer ungestümen Art, ihrer rauen Schale, ihren ungehobelten und immer viel zu lauten Erzählungen und in der Unsicherheit im Umgang mit gesellschaftlichen Gepflogenheiten.
Während ihre Mitschülerinnen von zuhause Geschichten über gepflegte Familienausflüge mitbringen, weiß Denise nur von Ereignissen aus der Kneipe zu berichten, vom „völlig besoffenen Leduc“ und wie er „auf den Bürgersteig gekotzt“ hatte und dass die Mutter „die Sauerei wegmachen“ musste. Schnell merkt sie jedoch, dass ihre Geschichten niemanden interessieren. Ihre Welt ist in der Schule nichts wert. Denise fühlt sich unterlegen, plump und dumm im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen, die ihr gepflegter, leichter, graziler erscheinen. Sie versucht die dicke Strickjacke abzulegen, die ihr die Mutter zu tragen gibt. Doch sie merkt schnell: Auch das führt nicht dazu, dass sie wie ihre Mitschülerinnen wird. Ihr fehlt der ganze Rest, die Anmut, das angeborene, unsichtbare Etwas.
Um die Unterschiede zu überwinden, entwickelt Denise Lerneifer und Ehrgeiz. Sie wehrt sich gegen die bildungsbürgerlichen Demütigungen der „Trantüten und Heulsusen“ in ihrer Klasse, die sie Überlegenheit und Vorsprung spüren lassen, aber beim Erhalt einer schlechten Note in Tränen ausbrechen. Und sie wehrt sich gegen die hochmütige Lehrerin, die ihre Geschichten unterdrückt. Denise wird Klassenbeste, und sie genießt die Genugtuung. Doch die Sprache, die in der Schule gesprochen wird, bleibt ihre größte Herausforderung. Es ist eine Sprache, bei der sie nichts fühlt. Nicht von Sachen, Zeug, Klamotten ist dort die Rede, sondern von Kleidung. Die neuen Worte sind federleicht und formschön, aber ohne Wärme. Sie sind nichts im Vergleich zu den derben, deftigen Ausdrücken, die direkt in Bauch, Herz oder Kopf fahren, die emotional berühren, zum Lachen bringen, Tränen fließen lassen oder zum Widerspruch herausfordern. Über die Formulierungen im Grammatikbuch beispielsweise kann Denise nur müde lächeln. Wenn dort steht, dass der „erboste Vater den Sohn rügt“, dann klingt das in ihren Ohren belanglos, fast zurückhaltend. Wenn dagegen die Mutter zuhause brüllt, das kleine Luder habe schon wieder den Käse der Kunden angetatscht, dann schwang da der geballte Zorn mit, dann wurde es finster im Laden und man musste in Deckung gehen.
Denise baut Barrieren zwischen beiden Welten auf, trägt zwei Sprachen in sich, um sich in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich auszudrücken. Während sie in der Sprache ihrer Familie benennen kann, was sie denkt und fühlt, ist die neu gelernte Sprache aus der Schule ein steriles Werkzeug, ein System aus Passwörtern für den Zugang zu einer anderen Gesellschaftsschicht. Eine widersprüchliche Mischung aus „sich anpassen müssen“ und „sich unterscheiden wollen“ wird zu einer merkwürdigen Kompetenz, um in beiden Welten bestehen zu können. Es ist eine Strategie, in der eine tief sitzende Abgrenzungskraft und eine empathische Feinsinnigkeit ihren Platz haben. „Sobald ich über die Ladenschwelle trete, spreche ich wieder mit meiner normalen Stimme, nicht mit der verstellten, viel zu weichen Stimme, die ich in der Schule benutze.“ Gute Schulnoten sind nichts, womit sie zu Hause glänzen möchte. Sie bleiben nur im Klassenzimmer wichtig, um sich vor den verbalen Herabwürdigungen ihrer Mitschülerinnen zu schützen. Gleichzeitig sind die derben Schimpfworte, die zu den schmutzig grauen Wänden und dem angebrannten Bohneneintopf ihres Elternhauses gehören, ein Zeichen der Dazugehörigkeit. Im Klassenzimmer dürfen sie jedoch keinen Platz haben.
Über die Jahre verfestigt sich das Gefühl in ihr, nirgendwo richtig zu sein. Einerseits die bis zur Verachtung wachsende Entfremdung von den Eltern, von den Schirm- oder Baskenmützen der Kneipensucher, von ihren verwaschenen, unförmigen Klamotten, ihren schwarzen Fingernägeln, von schlaff herabhängenden Armen und der unsicheren Haltung, von verbaler Unbeholfenheit und Gebrüll. Andererseits die arrogante Überlegenheit des Bildungsbürgertums, die sich in schicken Lederschuhen und Aktentaschen ausdrückt, in sauberen Händen, gepflegten Umgangsformen und der Fähigkeit, immer die richtigen Worte zu finden, egal wann und wo. Der gute Stil – einerseits eine sympathische Umgangsform, mit der sich Denise umgeben möchte, andererseits ein überhebliches Statement gegen die Klasse, aus der sie kommt. Denise fühlt sich abgestoßen von der anmaßenden Art, mit der Intellektuelle über ihre Klasse sprechen. Von den geistig Armen ist da die Rede, vom gesunden Menschenverstand des kleinen Mannes, von der Naivität des Volkes, dem einfache Leben, ihren Bauernweisheiten. Jedes Wort ein Blick herab, so sehr sie sich auch um Empathie mit den einfachen Menschen bemühen mögen.
Denise spürt, wie sehr ihre Herkunft bereits hinter ihr liegt. Doch während sie die Verbindung zu ihren Eltern verliert, stößt die Strategie aus Lerneifer, Abgrenzung und Anpassung an habituelle Grenzen. Denn alles was Denise ihrer neuen gebildeten Welt zu bieten hat, sind Geschichten, die sie selbst abstoßen. Unter die Wut, dass sie nie dazu gehören würde, mischen sich allgegenwärtige Widerständigkeit und Rebellion. Der Wunsch der Zugehörigkeit zum Bildungsbürgertum ist verlockend und abstoßend zugleich. Dass die Unterschiede zwischen ihrer alten und ihrer neuen Welt etwas mit Geld und Herkunft zu tun haben könnten, bleibt lang nur ein dumpfes Gefühl. Es zuzulassen wäre das Eingeständnis einer gescheiterten Strategie gewesen – einer Strategie, die sie seit ihrer Schulzeit entwickelt und perfektioniert hatte: dass man es aus eigener Kraft allen zeigen könne. Und so hält sie in ihrer ungerechten Wut Klassenunterschiede lange für bewusste Entscheidungen: Man konnte schließlich wählen, so glaubt sie, ob man in Sauberkeit oder Dreck leben möchte, ob man dem Sinn für Schönheit oder der Schlampigkeit und dem Kitsch den Vorrang gibt. In dieser Logik sind auch Sprache und rhetorische Gewandtheit nicht etwa habituelle Erscheinungen, sondern individuelle Gaben, die einschüchtern und demütigen. Die Schuld für diese Demütigungen sucht Denise schließlich bei den Eltern. „Sie haben mir nichts beigebracht, ihretwegen wurde ich in der Schule verspottet. Mademoiselle Lesur, wussten sie nicht, dass man das nicht sagt? Trotz meiner Vorsicht, trotz der Schranke, die ich zwischen der Schule und meinem Zuhause errichtet habe, dringt sie durch, schleicht sich in eine Hausaufgabe, in eine Antwort. Ich trug diese Sprache in mir. Dafür hasste ich meine Eltern.“
Ihre Aufstiegssehnsucht bekommt weitere Risse, als der bourgeoise, weltgewandte Marc sie wegen der Schwangerschaft umgehend verlässt. Die Traurigkeit über das Ende einer Liaison vermischte sich mit der Wut über das sichtbar gewordene Klassengefälle. Ihr Furor auf Marc und diejenigen, die keine Angst vor der Welt hatten, die tun und lassen konnten, was sie wollten, die sich nie gedemütigt fühlten und nie voller kräftezehrender Rastlosigkeit waren, wächst, als ihr bewusst wird, dass selbst ihr Bildungsaufstieg den Makel der Klassenherkunft trägt. Sie spürt: Bildung ist nicht gleich Bildung. Während Marc sich für alles interessierte, flüchtet Denise sich nur in die Literatur. Und so ist auch das Studium der Klassiker nichts weiter als ein Symptom ihrer Armut. Es bleibt eine verzweifelte Strategie, um ihrer Herkunft zu entfliehen. Mit falschen Worten hatte sie die leeren Schränke ihrer Klasse gefüllt und dabei bemerkt, wie wenig dies mit ihrer wahren Persönlichkeit zu tun hatte. „Ich habe immer nur meinen Hass in mich hineingefressen, gegen alles aufbegehrt, meine Bildung ist nichts als Schein.“
Annie Ernaux hat mit „Die leeren Schränke“ ein authentisch aufgewühltes wie aufwühlendes Buch vorgelegt. Es zeigt: Klassenerfahrungen sind kollektive Erfahrungen, aus denen es kein individuelles Entkommen gibt. Die Grenzen zwischen den Klassen sind abgeschirmt und bewacht. Wer auch immer versucht, sie zu überwinden, erntet habituelle Ächtung – aus beiden Richtungen. Die Unmöglichkeit des sozialen Aufstiegs öffnet schließlich den Blick dafür, wie untrennbar Herkunft und Persönlichkeit miteinander verbunden sind. Und in diesem Augenblick wird eine durch Wut und Entfremdung verdrängte Erinnerung an die Mutter, die ihr im Sommer ein Eis am Stiel vom Markt mitbringt, zum berührendsten Moment der gesamten Erzählung. Dass es halb geschmolzen ist, als sie zuhause ankommt, steht für die Fähigkeit zu tief empfundener Zuneigung und das Gespür für die Größe kleiner Gesten ebenso wie für die Unbeholfenheit derjenigen, die sich in allen Lebenslagen immer doppelt anstrengen müssen. „Sie schwitzte sogar um die Augen, so sehr hatte sie sich beeilt. Das Eis am Stiel tropft auf die lateinischen Verben der e-Konjugation, sie hat sich schrecklich abgehetzt, um es mir zu bringen. Die beiden haben alles für mich getan.“
„Die leeren Schränke“ ist das kraftvollste, das wütendste, das energischste aller Bücher, die Annie Ernaux ihrer Leserschaft in den letzten 50 Jahren geschenkt hat. Es legt die zwei Welten der Bildungsaufsteiger mit der Wucht selbst erfahrener Demütigungen unter eine Lupe. Dass sie dabei zum Teil die vulgäre Sprache ihrer Kindheit nutzt, ist ein Stilmittel, das ihre Wut authentisch visualisiert. Ihr Anspruch ist nicht, mit schönen Worten schöngeistige Literatur zu verfassen. Ernaux will die Geschichte ihrer Klasse erzählen, die raue Enge ihrer Herkunft und den als Fall in die Bodenlosigkeit getarnten eigenen Bildungsaufstieg. Sie zeigt, Klasse ist so viel mehr als finanzielle Armut oder materieller Reichtum. Und der Bildungsaufstieg so viel intensiver als eine gut genutzte Bildungschance. Handelten ihre späteren Bücher von berührenden Schilderungen über die Entfremdung von den Eltern und vom Dorf, in dem sie aufgewachsen war, ist ihr erstes Buch eine wütende Anklage. Es schildert den Schmerz paradoxer Widersprüche – die Ablehnung der eigenen Herkunft einerseits und die liebevolle Hinwendung zur ihr andererseits, die Sehnsucht nach dem Aufstieg ins Bildungsbürgertum einerseits und die stolze Ablehnung erduldeter Klassenverachtung andererseits. Es schildert aber vor allem die Stärke, diese Widersprüche trotz allem auszuhalten. Annie Ernaux gelingt ein wütender und unverstellter Blick auf die Verhältnisse und eine feinsinnige Darstellung derjenigen, die geteilt sind in zwei Hälften, den „Arsch“ nie auf, sondern immer zwischen den Stühlen, ein Blick auf ihre rastlose Suche nach echten Worten, um sie in die leer bleibenden Schränke zu stellen „Wir wären glücklicher, wenn sie nicht studiert hätte“, hatte der Vater einmal gesagt. Ich vielleicht auch, hatte Denise gedacht.
Diese Rezension ist der Februarausgabe der Zeitschrift Sozialismus unter dem Titel »Über falsche Sätze in leeren Schränken und die Wut einer Bildungsaufsteigerin« erschienen.
Annie Ernaux
Die leeren Schränke
Das Debüt der Nobelpreisträgerin nun endlich auf Deutsch.
Suhrkamp 2023
180 Seiten
23 Euro
Die Welt der Arbeit in den sozialen Medien
Artikel wurde am 13. März 2026 gedruckt. Die aktuelle Version gibt es unter https://betriebundgewerkschaft.de/keine-kultur-ohne-klasse/2024/03/annie-ernaux-die-leeren-schraenke/.