Politisch streiken? Ja, verdammt!
Das Streikrecht ist unter Beschuss – politisch, juristisch, medial. Während Konzerne und Lobbyverbände ungehindert Einfluss nehmen, bleibt abhängig Beschäftigten der politische Streik verwehrt. Ein Plädoyer für kollektive Handlungsmacht.
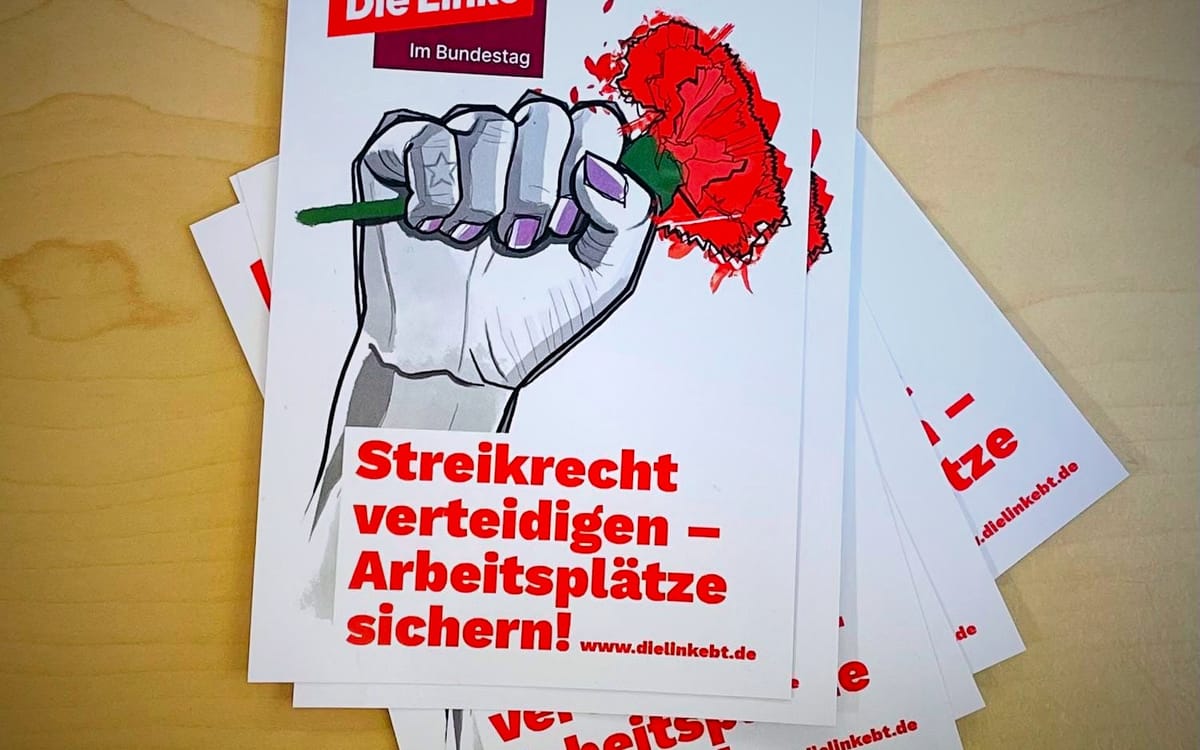
Das Streikrecht ist eines der wirksamsten Mittel, das abhängig Beschäftigten zur Verfügung steht, um ihre Interessen durchzusetzen. Es ist gelebte Demokratie von unten und Ausdruck kollektiver Gegenmacht. Jeder Versuch, dieses Recht einzuschränken – sei es durch Gesetze oder Urteile – ist ein Angriff auf unsere Handlungsfähigkeit und auf demokratische Mitbestimmung. Wenn Politiker das Streikrecht infrage stellen, geht es meist nicht um das Wohl der Allgemeinheit, sondern um wirtschaftliche Interessen. Besonders bei Streiks im öffentlichen Dienst oder in sogenannten „kritischen Infrastrukturen“ wird schnell mit „Verantwortung“ oder „Verhältnismäßigkeit“ argumentiert – um Kämpfe zu delegitimieren. Aber Solidarität lässt sich nicht verbieten!
Zeitenwende? Ja – für das Streikrecht!
Die Bundesregierung rüstet auf und propagiert die politische Zeitenwende. Doch Aufrüstung kostet – und das Geld dafür wird im Sozialstaat eingespart. Die Nationale Sicherheitsstrategie gibt das sogar offen zu. Das heizt die sozialen Verteilungskonflikte weiter an. Gleichzeitig wird der gesellschaftliche Rahmen für Arbeitskämpfe enger: Digitalisierung, Klimakrise, Globalisierung und ein zunehmend autoritärer Diskurs setzen das Streikrecht unter Druck. Denn in der Logik der Zeitenwende werden alle gesellschaftlichen Bereiche der Sicherheitspolitik untergeordnet. Das ist der entscheidende Paradigmenwechsel unserer Zeit. Deshalb müssen wir nicht nur verteidigen, was wir haben – wir müssen mehr fordern. Ein zentraler Hebel ist das Recht auf politischen Streik.
Nicht einschränken – ausweiten!
In Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes ist das Streikrecht indirekt durch die Koalitionsfreiheit geschützt. Doch explizit genannt ist es dort nicht – das schafft Angriffsflächen. Eine klare Verankerung im Grundgesetz wäre überfällig.
Doch es geht um mehr als nur Rechtssicherheit. Es geht um inhaltliche Ausweitung. Derzeit erlaubt das deutsche Recht nur „tariflich bezogene“ Streiks. Politische Streiks – also solche gegen Gesetze oder politische Maßnahmen – sind verboten oder rechtlich hoch umstritten. Auch Solidaritätsstreiks und Generalstreiks sind nicht erlaubt. Diese Beschränkungen aber leisten nicht nur der Entpolitisierung sozialer Bewegungen Vorschub und schwächen erheblich deren emanzipatorische Kraft. Sie entziehen zudem der Arbeiterbewegung einen großen Teil ihrer historischen Wirksamkeit, indem sie die heutigen Auseinandersetzungen von den mutigen Kämpfen derer entkoppeln, die einst zentrale Errungenschaften wie das Streikrecht, den Achtstundentag und die soziale Sicherung erstritten haben.
Die Linke macht Druck
Immer wenn im Bundestag versucht wurde, das Streikrecht einzuschränken, hat sich Die Linke dagegen gestellt. Im März 2024 hat sie einen Antrag eingebracht, der den politischen Streik legalisieren soll. Die Begründung: Nur wenn Beschäftigte politische Entscheidungen aktiv beeinflussen können, ist echte Demokratie möglich. Der Antrag betont, dass politische Streiks ein Gegengewicht zur Macht der Arbeitgeber sind – deren Einfluss sich über Lobbyismus, Medien und Institute längst verankert hat.
International ist Deutschland übrigens fast allein: Nur in Dänemark und hierzulande ist der politische Streik gesetzlich tabuisiert. In Frankreich, Italien oder Spanien ist er legal. Auch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) erkennt das Recht auf politische und Solidaritätsstreiks an. Deutschland steht also unter Reformdruck – nicht nur politisch, sondern auch völkerrechtlich.
Rechtsprechung von gestern – Kämpfe von heute
Der erste Grund für den Antrag lag in einem damals aktuellen Arbeitskampf: Die Stadt Leipzig wollte 2024 einen Streik bei den Verkehrsbetrieben verbieten. Begründung: Die Verbindung mit der Klimabewegung mache ihn „politisch“. Doch die Streikziele waren klassisch – mehr Lohn, bessere Arbeitszeiten. Die Richterin stellte fest, dass der Streik nicht politisch sei – auch wenn sich das Gericht hierzu durchringen musste, da eine gewisse Nähe zur Klimabewegung schon erkennbar gewesen war.
Warum aber haben die Arbeitgeber hier die uralte Rechtsprechung zum politischen Streik bemüht? Die Strategie war offensichtlich: Nicht die Forderungen wurden angegriffen, sondern das Bündnis. Doch: Ein Streik wird nicht „politisch“, nur weil er solidarisch geführt wird und es zu einem gesellschaftlichen Schulterschluss und gemeinsamen Demos kommt. Und ein Streik wird auch nicht illegal, nur weil sich die Streikziele leichter umsetzen ließen, wenn Politik sich für Daseinsvorsorge starkmacht und diese ausreichend finanziert. Jahrzehnte der Privatisierung haben Spuren hinterlassen. Viele Beschäftigte in diesen Branchen sind heute keine Beamten mehr, sondern abhängig Beschäftigte – damit haben sie auch ein Recht auf Streik!
Der "Megastreik" – und die Panik der Rechten
Der zweite Grund für den Antrag war der gemeinsame „Megastreik“ von ver.di und der EVG im März 2023. Er hatte spürbare Auswirkungen: Nahverkehr, Bahn und Flughäfen waren massiv betroffen. Und wie reagierten FDP und Union? Mit der altbekannten Leier: „Deutschland wird kaputtgestreikt“. Verkehrsminister Wissing sprach angesichts des Krieges in Europa von einem „Sicherheitsrisiko“, CDU-Politiker sprachen vom „Streik-Irrsinn“ und forderten sogar einen „Anti-Streik-Gipfel“.
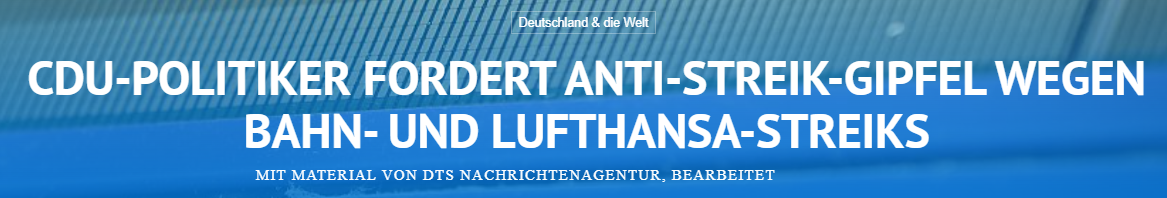
Fakten gegen Stimmungsmache
Ja, 2023 war ein streikintensives Jahr – 312 Arbeitskämpfe, rund 1,5 Millionen ausgefallene Arbeitstage. Aber im europäischen Vergleich? Ein Witz! In Deutschland fallen im Durchschnitt 18 Streiktage pro 1.000 Beschäftigte an. In Frankreich sind es 80, in Belgien 164, in Finnland sogar 434. Deutschland liegt seit Jahrzehnten bestenfalls im Mittelfeld. Wer von „Streikexzessen“ redet, will Stimmung machen, nicht aufklären.

Rollback und Klassenhass
Mittlerweile ist klar: Die Politik der Zeitenwende duldet keinen Widerspruch. Kippt die gesellschaftliche Stimmung, sinken in der Folge die Hemmschwellen. Die Debatte zur Refinanzierung der Aufrüstung wird enthemmt geführt. Kanzler Merz nennt arbeitende Menschen indirekt faul, weil sie nicht genug Mehrarbeit leisten und macht sich über Work-Life-Balance lustig. Seine Wirtschaftsministerin fordert die Rente mit 70 und Wirtschaftsbosse wollen Feiertage gestrichen sehen, auch wenn das volkswirtschaftlich kontraproduktiv ist. Die Arbeitgeber finden, der Achtstundentag sei aus der Zeit gefallen und stellen die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Frage. Und erst jüngst freute sich der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände in der Metall- und Elektroindustrie über die allein den Unternehmen zugutekommenden Senkungen bei Energiepreisen und Steuern und wünschte sich im gleichen Atemzug ein ähnlich beherztes Vorgehen der Bundesregierung bei den Arbeitskosten – also den Lohnnebenkosten, der Finanzierungsader unserer Sozialversicherungen. Gefühlt werden im 24-Stunden-Takt Errungenschaften preis geboten, denen einst mutige und langwierige (Arbeits-)Kämpfe vorausgegangen sind.
Arbeitgeber und ihre Verbände hatten das Streikrecht schon immer im Visier. Neu aber ist: Die Diffamierung von Streikenden und ihren Gewerkschaften kommt nicht mehr nur von FDP und Union. Auch den Verkehrsminister im Ländle „…nerven die Streiks“ bei der Bahn. Winfried Hermann ist Grüner. Pistorius sieht durch gute Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst die Ausstattung bei der Bundeswehr gefährdet und aus der Berliner SPD-Fraktion wurden ver.di und GEW über X dazu aufgefordert, die Kitastreiks zu beenden. Diese Dynamik ist besorgniserregend. Sie deutet auf eine mögliche gesamtgesellschaftliche Akzeptanz von Einschränkungen hin, legitimiert durch den sicherheitspolitischen Diskurs der Zeitenwende.
Was jetzt zu tun ist
Die Linke steht an der Seite der Streikenden. Immer. Sie verteidigt das Streikrecht nicht nur, sie will es ausweiten. Der politische Streik ist Teil ihrer Programmatik – seit Jahren. Das Streikrecht wurde erkämpft – durch Arbeitskämpfe, durch Mut, durch Solidarität. Es ist kein Geschenk, sondern Ausdruck kollektiver Macht von unten. Heute ist es bedroht: durch politische Einschränkungen, juristische Hürden und öffentliche Hetze. Streiks sind gelebte Solidarität – innerhalb von Betrieben, aber auch über sie hinaus. Wer das Streikrecht angreift, will uns spalten. Deshalb: Wehren wir uns gemeinsam! Fünf Maßnahmen zur Stärkung des Streikrechts:
- Juristische Absicherung und Erweiterung: Eine explizite Verankerung des Streikrechts im Grundgesetz, etwa durch einen eigenen Absatz oder durch eine Klarstellung in Art. 9, wäre ein wichtiger Schritt, um die Rechtsgrundlage zu stärken. Gleichzeitig sollte es auf alle Formen kollektiver Arbeitskämpfe ausgeweitet werden, etwa auch auf politische Streiks, Solidaritätsstreiks und Generalstreiks, die derzeit rechtlich nicht oder nur eingeschränkt erlaubt sind.
- Einschränkungen zurückweisen: Gerichte und Gesetzgeber haben in den letzten Jahren zunehmend versucht, das Streikrecht einzuengen, etwa durch hohe Anforderungen an Verhältnismäßigkeit oder durch eine Stärkung der sogenannten „Tarifeinheit“. Solche Hürden machen Arbeitskämpfe schwerer planbar und hemmen die Mobilisierungsfähigkeit der Gewerkschaften. Hier braucht es politischen Druck für eine arbeitnehmerfreundliche Auslegung der Gesetze und eine Stärkung der kollektiven Rechte gegenüber dem Besitzstandsschutz der Arbeitgeberseite.
- Öffentlichen Rückhalt fördern: Ein starkes Streikrecht lebt nicht nur von juristischen Grundlagen, sondern auch von gesellschaftlicher Unterstützung. Deshalb ist es wichtig, das gesellschaftliche Bewusstsein für die Bedeutung des Streikrechts zu stärken. Bildungsarbeit in (Berufs-)Schulen, gewerkschaftliche Solidaritätskampagnen, öffentlichkeitswirksame Aufklärung sowie Allianzen mit sozialen Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Gruppen können helfen, Unterstützung für streikende Beschäftigte zu gewinnen und politische Angriffe abzuwehren.
- Internationale Solidarität und Druck: Viele Bedrohungen des Streikrechts entstehen auf internationaler Ebene, sei es durch EU-Richtlinien, Freihandelsabkommen oder die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Internationale gewerkschaftliche Vernetzung ist notwendig, um grenzüberschreitend für kollektive Rechte zu kämpfen und Druck auf politische Entscheidungsträger auszuüben - aber auch, um internationale Solidarität zu organisieren.
- Streikrecht demokratisieren: In vielen Betrieben entscheiden nicht die Beschäftigten selbst über Arbeitskämpfe, sondern Funktionärsstrukturen. Eine Stärkung betrieblicher Streikkomitees, Urabstimmungen und basisorientierter Organisierungsformen kann helfen, das Streikrecht wieder stärker in den Händen der Beschäftigten selbst zu verankern. Damit wird Streik nicht nur zum Mittel der Tarifpolitik, sondern auch zum Ausdruck kollektiver Selbstermächtigung.
Um das Streikrecht zu schützen und zu stärken ist eine Vielzahl von Maßnahmen notwendig. Vor allem aber braucht es Beschäftigte, die bereit sind, dieses Recht nicht nur zu verteidigen, sondern es zu nutzen. Denn nur ein gelebtes Streikrecht ist ein starkes Streikrecht.
Zum Thema:



Artikel wurde am 18. Feb. 2026 gedruckt. Die aktuelle Version gibt es unter https://betriebundgewerkschaft.de/aus-dem-bundestag/2025/07/politisch-streiken-ja-verdammt/.








