Herbst der Reformen - Zeit für Protest
Sozialabbau ebnet den Weg nach rechts: Union und AfD rücken zusammen, während Arbeitgeber Einschnitte diktieren. Jetzt müssen Gewerkschaften, Verbände und Linke gemeinsam Widerstand organisieren. Von Ulrike Eifler.

Der „Herbst der Reformen“ wird vorbereitet. Dazu gehört, möglichen Gegenprotest zu unterbinden. Seit Wochen werden Spaltungslinien durch die Berichterstattung über Bürgergeldempfänger, Rentner, Geflüchtete oder den überbordenden Sozialstaat bedient. Und diejenigen, die das unbeeindruckt lässt, sollen mit dem Hinweis auf eine drohende Regierung unter Beteiligung der AfD diszipliniert werden. Die kommenden sechs Monate seien entscheidend für einen konjunkturellen Aufschwung in Deutschland, sagte erst kürzlich der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch. Sollte innerhalb des nächsten halben Jahres keine wirtschaftliche Besserung eintreten, müsse es so harte Sozialkürzungen geben, dass „demokratische Verwerfungen zu befürchten“ wären.
Kochs Drohung sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Sie zeigt: Die Union zieht offenbar den Bruch der Koalition zugunsten einer Zusammenarbeit mit der AfD in Erwägung. Hintergrund dürfte das massive Drängen der Arbeitgeber- und Industrieverbände sein, zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit den Sozialstaat zurückzubauen und die Arbeitswelt zu deregulieren. Auf den Versuch, die Wirtschaftswende einzuleiten, folgt die Suche nach neoliberalen Mehrheiten.
Seit Monaten vergeht kein Tag, an dem die Bundesregierung nicht den Eindruck vermittelt, Sozialstaat, Arbeitsschutzgesetze und Regulierung seien zur Wachstumsgrenze geworden. Hinter den Kulissen werden Einschnitte vorbereitet, die alle bisherigen Sozialreformen weit in den Schatten stellen könnten. „Es wird ein Herbst, der sich gewaschen hat“, droht CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Markus Söder spricht vom „Update des Sozialstaates“, Friedrich Merz sogar vom „Epochenbruch“.
Die Bundesregierung hat offenbar sämtliche Denkblockaden abgelegt. Kürzungen beim Bürgergeld, Abschaffung des Acht-Stunden-Tages, Streichung von Feiertagen, Aufweichung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Rente mit 70 - der gesamte Katalog sozialer Grausamkeiten liegt auf dem Tisch.
Die Debatte folgt dem Druck neoliberaler Ökonomen und Arbeitgeberverbände, die schon seit längerem für eine Wirtschaftswende trommeln. Noch zu Jahresbeginn waren in mehreren Städten Unternehmer für einen „Wirtschaftswarntag" auf die Straße gegangen. Sie forderten einen Kurswechsel bei Energiekosten, Steuern, Sozialversicherung, Bürokratie und Infrastruktur. Wenige Wochen nach der Wahl verkündete Gesamtmetall ungeniert die Arbeit an einem Gesetzentwurf zur Einschränkung des Streikrechtes. Die „Verrechtlichung ganzer Lebensbereiche“ müsse beendet und stattdessen „Räume für mehr Risikobereitschaft geöffnet“ werden, riet die Ökonomin Nicola Fuchs-Schündeln den schwarz-roten Koalitionären auf deren Würzburger Klausur. Und nachdem der Geschäftsführer des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft, Marcel Fratzscher, ein Arbeitspflichtjahr für Rentner in die Debatte spülte, forderte nur wenige Tage später der Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall, Volker Schmidt, Arztbesuche nur noch gegen Vorkasse. Die Anzeichen mehren sich, dass es um mehr als einen minimalen Umbau des Sozialstaates gehen wird. Dieses Mal geht es an die Grundfeste gewerkschaftlicher Errungenschaften.
Gegenwehr in den Reihen der SPD sucht man vergebens. Längst zeichnet sich auch bei den SPD-Ministern eine Gesprächsbereitschaft über Sozialkürzungen ab. So demonstrierten die Koalitionäre auf ihrer Sommerklausur in Würzburg Geschlossenheit und kündigten einmütig den „Herbst der Reformen“ an. Einzelheiten sind noch nicht bekannt, aber die scheinbar unabhängigen „Kommissionen“ haben längst ihre Arbeit zur Novellierung der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung aufgenommen. Und nicht nur Merz treibt die Sozialabbau-Debatte mit Äußerungen voran, die Menschen hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Auch Vize-Kanzler und SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil sagt: „Wir müssen den Menschen etwas abverlangen“. Dass Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas entgegen ihrer „Bullshit“-Schimpftirade gegen Merz eine Nullrunde beim Bürgergeld ankündigt, passt da ins Bild.
Weil es in der SPD aber auch Stimmen wie die von Ralf Stegner und Juso-Chef Philipp Türmer gibt, die die Austeritätspolitik ablehnen, erhöhen vor allem konservative Medien den Druck. „Die SPD kann so nicht weitermachen“, trommelt seit Wochen die „Neue Züricher Zeitung“. Und die „Welt“ ätzt: „Statt den Linken nachzueifern, könnte die SPD eine wichtige Leerstelle füllen“. Schützenhilfe bekommen die SPD-Linken dagegen von den Sozialverbänden. Und auch die Gewerkschaften kritisieren die Abschaffung des Acht-Stunden-Tages. So verwies der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, Freddy Adjan, auf die Gefahr, dass künftig 73,5-Stunden-Wochen möglich wären, ginge es nach der Großen Koalition.
Die noch vorsichtig geäußerte Kritik aus Sozialverbänden, Gewerkschaften und SPD-Linken deutet an: Der Kurs aus Austerität und Aufrüstung wird möglicherweise nicht widerspruchslos bleiben.
Deshalb und auch angesichts neuer rechnerischer Mehrheiten mit der AfD wächst innerhalb der Union die Bereitschaft, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD bei der Bundestagswahl fast alle Wahlkreise für sich gewinnen konnte, ist die Diskussion über eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD schon seit längerem im Gange. Das zeigte nicht zuletzt die Bemerkung des Greizer Kreistagsabgeordneten Gunnar Raffke, die Brandmauer aufzugeben und es mit der AfD zu versuchen. Auf der Bundesebene hatte Merz bereits Ende Januar mittels eines Antrages zur Verschärfung der Migrationspolitik eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Union und AfD ausgetestet. Weil seine Offerte massiven gesellschaftlichen Widerspruch auslöste, stieß der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn nur wenige Wochen später eine Debatte über die Normalisierung des Umgangs mit der AfD an. Flankiert wurde diese unter anderem von Außenminister Johann Wadephul mit der Bemerkung, auch AfD-Abgeordnete müssten zu Ausschussvorsitzenden gewählt werden.
Schaut man sich Wahlprogramm, Anträge und Abstimmungsverhalten der AfD an, wird schnell klar: Eine Regierung unter Beteiligung der AfD würde mit enormen Angriffen auf die Welt der Arbeit einhergehen. Mehrfach stimmte die Partei gegen den Mindestlohn. Auch ein Tariftreuegesetz zur Stärkung der Tarifbindung lehnt sie ab. Eine Analyse des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigt, das Programm der AfD würde eine weitere Umverteilung von unten nach oben bewirken. Dass sich die Partei mit dem Verein „Zentrum“ zum wiederholten Mal für die Betriebsratswahlen rüstet und dies obendrein mit der Ansage tut, den DGB-Gewerkschaften das Wasser abgraben zu wollen, verdeutlicht, dass insbesondere die Gewerkschaften nichts Gutes von einer solchen Regierung zu erwarten hätten. Möglicherweise haben sich die Arbeitgeber- und Industrieverbände im Januar anlässlich der parlamentarischen Offerte von Merz an die AfD auch deshalb mit Kritik zurückgehalten, weil ihnen eine Schwächung der Gewerkschaften durchaus entgegenkäme.
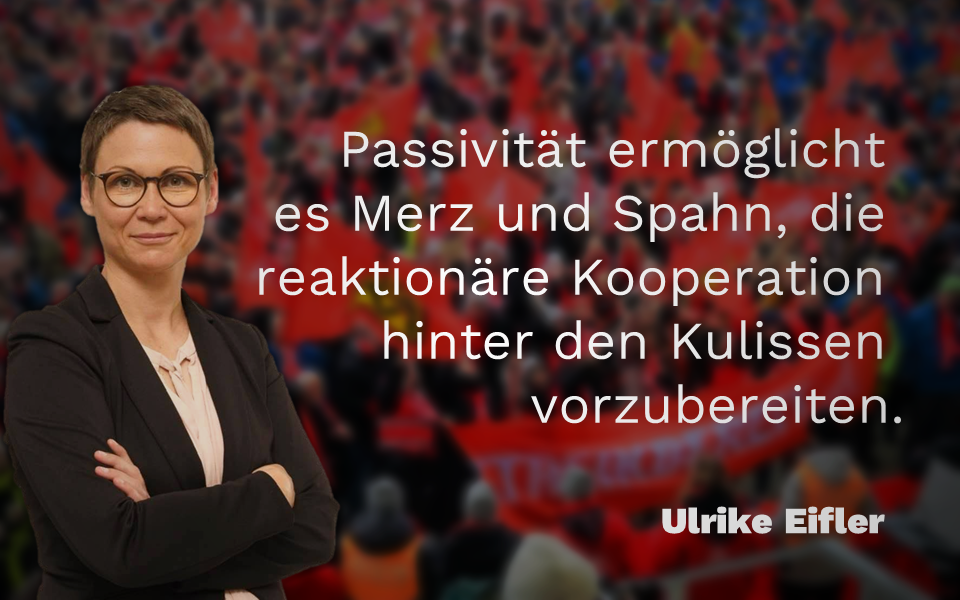
Dass der deutsche Faschismus ein Herrschaftsinstrument war, zu dem die Funktionseliten der Weimarer Republik gegriffen hatten, „nachdem die Demokratie, nicht mehr den Profit sicherstellen“ und „mit den Herrschaftsmethoden der Demokratie nicht mehr zu regieren war“, hatte der langjährige Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg, Willi Bleicher, bereits vor vielen Jahrzehnten analysiert. Die politische Linke ist also zu Recht besorgt. Aus dieser Sorge ergibt sich ein strategisches Dilemma. Besser den Sozialabbau von Union und SPD tolerieren, als den Bruch zwischen den Koalitionären und eine AfD-Regierung zu provozieren? Die Sorge ist berechtigt, verdichten sich doch die Anzeichen, dass die Union, lässt sich der „Herbst der Reformen“ nicht mit der SPD umsetzen, für eine neoliberale Mehrheit mit der AfD bereitsteht. Die drohende Alternative einer konservativ-rechten Bundesregierung könnte sich also folgenschwer auf linke Gegenstrategien auswirken und diese lähmen.
Vor dem Hintergrund sozialer Einschnitte, die auf die Zerschlagung des Sozialstaates hinauslaufen würden, trägt jedoch die Argumentation von der SPD als kleinerem Übel nicht mehr. Statt die Große Koalition zu schonen, muss die politische Linke ihre gesamte Mobilisierungskraft in die Waagschale werfen, um diese Angriffe zurückzudrängen. Insbesondere die Gewerkschaften müssten zum Motor für den Aufbau gesellschaftlicher Bündnisse mit Kirchen, Sozialverbänden und lokalen Initiativen werden. Ein Blick nach Belgien zeigt, wie das geht. Seit dem Frühjahr organisieren die drei großen Gewerkschaftsbünde ihre Proteste gegen die Kürzungspläne der rechten Arizona-Regierung. Auch in Frankreich gehen Hunderttausende gegen die Macron-Regierung auf die Straße.
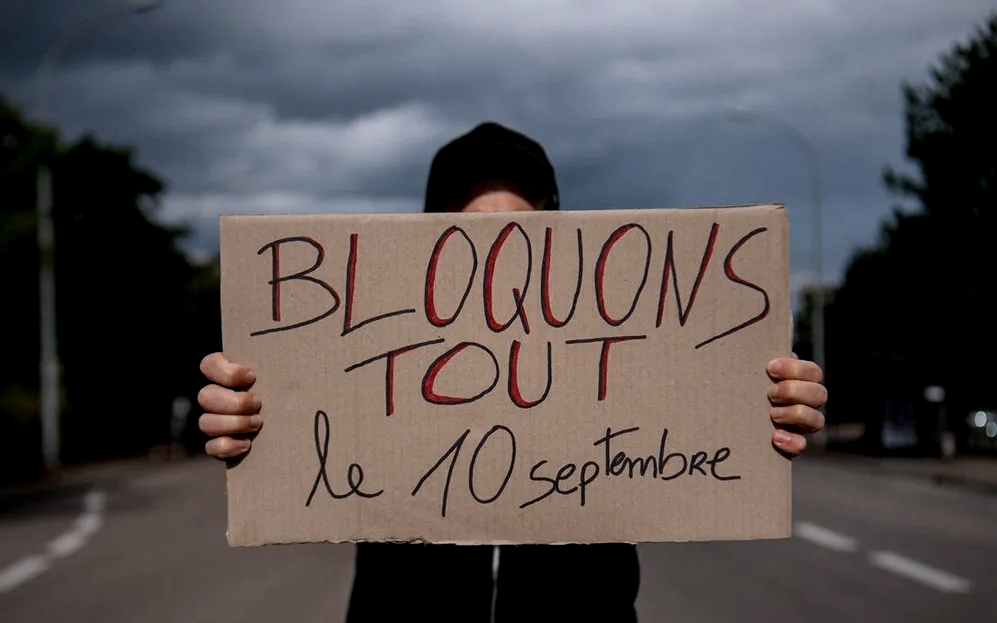
Der Aufstieg der AfD lässt sich nicht im Wartestand verhindern. Im Gegenteil: Passivität ermöglicht es Merz und Spahn, die reaktionäre Kooperation hinter den Kulissen vorzubereiten. Läuft der „Herbst der Reformen“ ohne nennenswerten Protest durch, ist der Aufstieg der AfD zur stärksten politischen Kraft möglicherweise nicht mehr aufzuhalten.
Auf unserer Seite von Ulrike Eifler
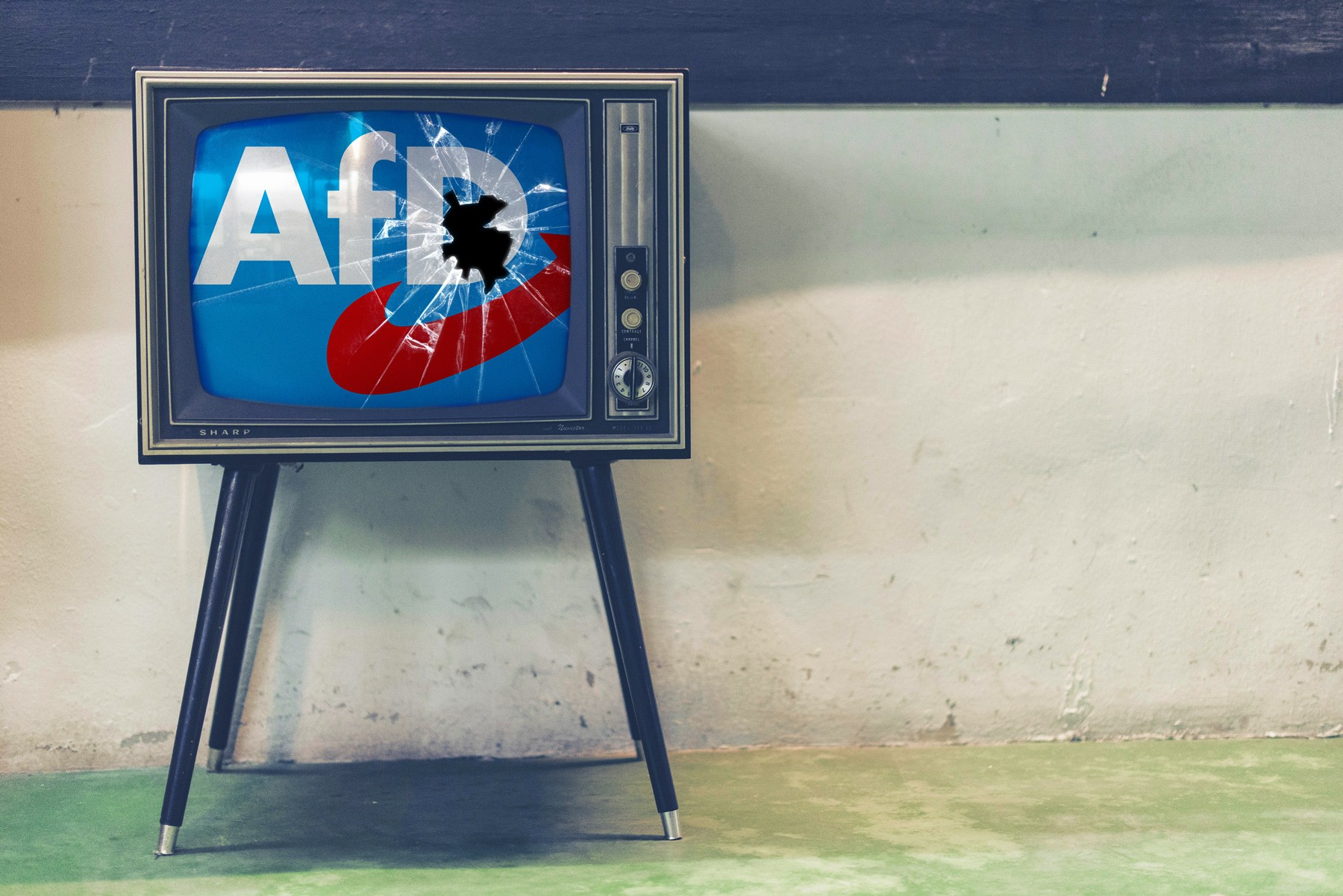


Artikel wurde am 18. Feb. 2026 gedruckt. Die aktuelle Version gibt es unter https://betriebundgewerkschaft.de/blog/2025/10/her/.









